

|
|
|

|
Vorbemerkung:
Im Dienste der Weltgesundheitsorganisation (WHO) der Vereinten Nationen (UNO) hielt E. W. Baader im Zeitraum vom November 1958 bis März 1959 am Hohen Institut für Öffentliche Gesundheitspflege in Alexandria Vorlesungen für arabische Ärzte, Chemiker und Techniker. Das Institut umfasste 9 Abteilungen:
Epidemiologie u. Mikrobiologie, Ernährungswissenschaft, Arbeitsmedizin, chemisch-technische Abteilung, sanitäre Technik, öffentliches Gesundheitswesen, Parasitologie, landwirtschaftliche und Tropenhygiene und Statistik.
Die seinerzeitige ägyptische Regierung vergab etwa 50 Stipendien für das Studium, das zum Erwerb des Grades eines ‚Masters’ bzw. auch ‚Doctor of Public Health’ berechtigte.
Besuch des Natrontales und der Wüstenklöster
(Teil I – Anfang Februar 1959):
Das Tote Meer in Palästina ist wohlbekannt. Daß aber auch Ägypten ein totes Meer, den Natronsee, besitzt ist weniger bekannt. Eine Kette von 10 Seen, deren tote Oberfläche violett schimmert, zieht sich parallel von Süden nach Norden in einer 20 m unter dem Meeresspiegel liegenden Senke dahin. Etwa auf dem halben Wege der Wüstenstraße Alexandria – Kairo befindet sich ein Rasthaus (für den Autoverkehr) und von ihm führt nach Westen eine Piste zum Salzsee.
Landkarte
Afrika, Nildelta und Landenge von Sues (3 Punkte = Ruine, Dreieck = Pyramide) [1]
Von Tausenden von Besuchern des Nillandes wird nur ganz selten mal einer diesen abgelegenen Ort aufsuchen. Bis 1947 hatte eine englische Gesellschaft die Natronlager des Sees abgebaut, seit 1952 tun das die Ägypter im eigenen Staatsbetrieb. Der Direktor unseres Hohen Institutes für Volksgesundheit hatte mir den Institutswagen für eine Dienstfahrt zum Wādī an-Naṭrūn (arabisch وادي النطرون) zur Verfügung gestellt und der Direktor des Werkes, Oberst Salak Hedaiet, war eigens aus Kairo herübergekommen, um uns zu führen. Die Wüstensiedlung zählt 8.000 Köpfe, darunter zahlreiche Kinder, die in Scharen vor den einfachen Lehmhütten spielten. 1.200 Menschen finden ihr Brot in den ausgedehnten Staatsbetrieben, die mich durch ihre verblüffende Vielfältigkeit überraschten. Natron- und Sodagewinnung, Karbidherstellung, Seifenfabrik. Eine Glasbläserei für Flaschen, wo ich erstmalig nach 30 Jahren wieder typische Backenbläser mit schlaff geblasenen Wangen sah, die wie beim Frosch überdehnbar sind. Große Tischler- und Möbelwerkstätten, Glaspipetten, Glasstäbeherstellung. Ganz besonders interessant die Teppichweberei. Jeweils 6 etwa 8-10 jährige Kinder an einem Webstuhl, die von einem Vorsager angeleitet werden. Dieser hat das Muster des zu webenen Teppichs in der Hand und kommandiert mit lauter timme die Fäden und Farben. Die Kinder plappern oder singen nach. Mag auch in Europa das Wort „Kinderarbeit“ Gruseln verursachen, unter den hiesigen Verhältnissen, Familien mit 9-14 Kindern) ist sie sicher vertretbar, da die Familie ihr Einkommen erhöht und die Kinder nur einige Stunden vormittags arbeiten, nachmittags kommt etwas Schule und mit anderen Kindern abwechseln. Der ägyptische Teppich ist jedoch wertmäßig hinter Persern und Kaukasiern zurückstehend, in der Gegend von Assiut sind die besten (braune und graue Töne), die auch im Wādī an-Naṭrūn gewebt wurden. Doch hatten sie auch viel bunte an Smyrna erinnernde Großteppiche. Man zeite uns auch die Färberei, wo die Wolle mit deutschen Anilinfarben in Bottichen gefärbt wurde. Eine andere Abteilung war der Bau von Rundfunkgeräten. Auch landwirtschaftliche Anlagen hat das Staatsunternehmen, die mich in der Wüste erstaunten. Große Rizinusölplantagen, Apfelsinen und Pampelmusen, Hühner, Enten, Gänse, Schafszucht, Rinder und Wasserbüffel. Wenn die Seeufer in der Erdsenke auch keine Ufer und verschiedenen starken Natrongehalt, sow waren doch auf den höher gelegenen Landstrichen Gemüsefelder und die eben erwähnten Plantagen und Tierzuchtställe. Das Wādī an-Naṭrūn hat aber noch eine andere Sehenswürdigkeit, die mich lockte. Auf den sandigen Hügeln, nahe den Seen liegen seit über 1.500 Jahren christliche Klöster, die in den ersten christlichen Jahrhunderten hier in dieser völligen Weltabgeschiedenheit errichtet wurden. es war nicht Weltflucht, welche die ersten Erimiten und Möche ihren Aufenthalt in den Höhlen der Wüste nehmen ließ. Die Wüste mit ihren Dämonen und Geistern galt als das Reich des Teufels und so wollten diese Frühchristen den Kampf gegen den Teufel in seinem eigenen Revier aufnehmen und ihr Leben dem Kampf gegen die Mächte der Finsternis weihen. Noch heute sind im Wādī vier altchristliche (koptische) Klöster, deren Insassen die alten Regeln des Möchstums bewahren und ein „engelhaftes Leben“ führen. Dazu gehören Fasten, Keuschheit, Buße und Gottesdienste. Sie sind also nicht verpflichtet, wie die meisten unserer europäischen Mönchsorden, Unterricht zu geben, Studien zu betreiben oder wie unsere Cisterzienser und Prämonstratienzer in Chorin und Lehnin usw. einst Ackerbau und Viehzucht zu lehren. Es hätte mich nun außerordentlich interessiert, solch Klosterleben kennen zu lernen, das die Jahrhunderte überdauerte. Der Zutritt ist jedoch nicht einfach. Seine Seligkeit, Stephanos I., Patriarch der koptischen Kirche, hatte nun seine Erlaubnis erteilt, daß ich die Klöster besuche. Hierzu ist jedoch ein Jeep nötig, da alle anderen Autos im Wüstensande stecken bleiben. Leider, leider war der Jeep nicht fahrbereit, bzw. reparaturbedürftig, als wir einen solchen mieten wollten. Ich versuchte nun mit dem Dienstwagen soweit zu kommen, wie dieser ohne Schaden zu fahren verantwortbar war. Von dort wollte ich es zu Fuß versuchen. Doch führte der Weg zunächst in eine Schlucht, deren aufgeweichter glitschiger Boden für Autos unpassierbar war. Nun versuchte ich es zu Fuß, zuerst blieb der linke Halbschuh im Boden stecken, als ich versuchte, den Fuß wieder hineinzubringen, rutschte ich mit dem Strumpf in den Brei, dann folgte der rechte Schuh. Bei diesem Tempo hätte ich auch das nächste Kloster nicht vor Sonnenuntergang erreichen können und so mußte ich meinen Plan für diesmal aufgeben.
Eines der größten und eigenartigsten Abenteuer meines Ägyptenaufenthaltes liegt hinter mir: der Besuch der noch heute bewohnten Wüstenklöster im Wādī an-Naṭrūn. Du findest über ihre Vorgeschichte schon einiges in meinem Brief über den Besuch der Soda-, Seifen- und Glasfabrik des Dorfes und meinen missglückten Versuch, ein Kloster zu Fuß zu erreichen, wobei mir die Schuhe im Wüstenschlamm stecken blieben. Seitdem hatte ich zwar die Ruinen des St. Simeons-Klosters in der Wüste bei Assuan besucht, aber ich wollte doch gern die noch „lebenden“ Klöster in der Nitritwüste kennen lernen, von denen nur 4 von rund 40 die Jahrhunderte überlebt haben. Am Freitag, dem 13. Februar 9 Uhr früh fuhr ich mit zwei Herren des deutschen Konsulats und Dr. Valic bei Regenschauern die Dir schon geschilderte Wüstenstraße längs des Mariutssees in Richtung Kairo bis zum Rasthaus, wo wir unseren Wagen stehen ließen, um uns einem zuvor vom Konsulat telefonisch bestellten Jeep anzuvertrauen. Der Regen hatte aufgehört und bei lachend blauem Himmel ging die Fahrt querfeldein in die Wüste in Richtung des nördlichsten und ältesten Klosters Dair Al-Baramus. Dair heißt auf arabisch Kloster, „Paromeos“ ist abgeleitet von koptisch Pa-Romeos, zu deutsch ‚Römer’. Denn der berühmte Römer Arsenius, Hauslehrer der Söhne des römischen Kaisers Theodosius, wurde Mönche und gründete 394 dies älteste Gemeinschaftskloster des Natrontales, nachdem zuvor schon einige Mönche als Erimiten hier in Steinhöhlen wohnten. 5 große Überfälle durch die Bewohner der westlichen anschließenden lybischen Wüste hatte das Kloster zu bestehen, deren Zeiten noch heute verzeichnet sind. Es war in den Jahren 407, 410, 444, 507 und 817. Jedes Mal wurden Mönche erschlagen, das Kloster geplündert, doch jedes Mal kehrte der eine oder andere von der Flucht oder von der Gefangenschaft zurück, fand Glaubensgenossen und so bauten sie mutig das Kloster wieder auf. Daher ist das andächtige Leben in diesem Kloster niemals völlig erloschen. Doch schließlich entschloß man sich in der Mitte des 9. Jahrhunderts einen Schutzwall gegen weitere Überfälle zu bauen. Seitdem umgibt ein 10-11 Meter hoher, 2 Meter dicker Wall mit einem Brustwehrgang die gesamten Klosteranlagen. Als einziger Zugang ist ein Tor in der Wallmauer mit einer niedrigen eisenbeschlagenen Tür. Als uns unser Jeep bis vor die Klostermauern geschaukelt hatte, zogen wir an einem Glockenstrick, der neben dem Eingang herabhing. Erwartungsvolle Minuten, bis endlich von der Wallhöhe als Antwort auf unser Glockenläuten eine Stimme arabisch fragte, was unser Begehr, wie viel wir seien und woher wir kämen. Nachdem unser arabischer Jeepfahrer für uns Bescheid erteilte, kündigte die Stimme wir sollten warten. Das taten wir mit christlicher Demut im Sande versinkend vor der schmucklosen und hohen gelben Mauer. Dann endlich ein Geräusch, knarrend ging die kleine Eingangspforte und ein umfangreicher Mönch mit prachtvollem Charakterkopf, bärtig wie der Göttervater Zeus, mit wulstigen Lippen und gütig blickenden pechschwarzen Augen streckte mir als dem weißhaarigen Ältesten herzlich seine Hand entgegen. Ich stellte ihm meine Begleitung vor. Der Mönch sprach englisch, alle anderen Möche arabisch. Sie beten auch arabisch oder benutzten noch die alte koptische Liturgie. Wir schritten zunächst durch einen etwa 6-8 Meter langen Gewölbegang und kamen dann durch ein zweites Tor, das das Kloster nach innen abschließt. Über dem Gewölbegang befindes sich ein Torhaus mit einem Zimmer wie ein Fassgewölbe, von dem eine Tür zu Glöcklein auf dem Dach führt, von wo die Mönchsstimme über unseren Zutritt verhandelte. Von hier aus sieht man, wie die Wallmauern die verschiedenen Teile der Klosteranlage umschließen: die Hauptkirche der Hlg. Jungfrau, zahlreiche Kapellen, die Wohnzellen der Mönche, den Gemüsegarten, die Wasserpumpe, die Palmenstämme u.a. Unser freundlicher Mönch führte uns zuerst in das zweistöckige Gästehaus des Klosters mit anmutiger Holzbalustrade. In einem Saal mit uralten Plüschsesseln, die gut einige Jahrhunderte erlebt haben mögen, und dessen Wände mit den Bildern und Fotes der Patriarchen geschmückt waren, zu denen sich noch ein vergilbtes, gerahmtes Dokument in arabischen Schriftzügen gesellte, das eine Bestätigung der Privilegien und Eigentumsrechte des Klosters durch die ägyptische Regierung enthielt, wurde uns als Willkommen türkischer Kaffee serviert. In dieser würdigen Umgebung erfuhren wir nun Näheres über die Geschichte des nunmehr 1565 Jahre alten Baramus-Kloster.
Nach Errichtung des Schutzwalls wurde es in den Jahren 866 und 1069 nochmals überfallen, der angerichtete Schaden war beträchtlich, aber die Mönche blieben am Leben. Seither hat niemand mehr ihre Ruhe gestört. Wir besuchten den mächtigen Fluchtturm, der alle Gebäude des Wallinneren weit überragt. Steintreppen führten auf eine Plattform und von ihr gelangt man über eine hölzerne Zugbrücke zum Turm, in dem die Mönche bei Überfällen Zuflucht fanden. An der Vorderseite des Wohnturms befindet sich eine Steinnische, welche die bei Gefahr hochgezogene Zugbrücke aufnahm. Der Turm hat Wohnzellen und Speiseräume für die Mönche und im dritten Stock befindet sich eine kleine Kirche, die dem Heiligen Michael geweiht ist. Von der Plattform des Turmdaches schweift der Blick weit in die Wüste, die die Wallmauern des Klosters auf allen 4 Seiten umgibt. Auf der Plattform hatte sich ein Eremit seine Hausung erbaut. Ich sah ein Handtuch, eine Töpfe und Teller und einen gebrechlichen Stuhl vor seiner Klause. Am Fuße des Turmes ein backofenartiges langgestrecktes Gebilde aus Stein, weiß gekalkt und mit einem Holzkreuz auf dem gewölbtem Rücken. Es ist der Friedhof der Mönche. Der Leichnam wird in das Steingewölbe geschoben, nachdem einige Ziegel aus der Vorderseite des Steinhügels gebrochen wurden, die nach der Beisetzung ihn wieder schließen. Dann besuchten wir die zweitürmige Hauptkirche der Heiligen Jungfrau Maria. Sie enthält schön geschnitzte Holztüren und Gatter, eine Kanzel im Stil der Fatimiden, schöne alte Teppiche im Chor und im Allerheiligsten. Die Hauptwand bedeckt mit stark nachgedunkelten Ikonen und den Bildern vieler Heiligen, so des Erzengels Michael, des Heiligen Georg mit dem Dorchen, aber auch ein Bild der kaiserlichen Jünglinge. Die Körper derselben (Maximus und Domitius) liegen in einem Schrein und ebenso zeigte man mir in einem holzgeschnitzten Wandschrein eine im Kloster hochgeehrte Reliquie, die Gebeine des Vaters Mose, des Anba Musa, eines frommen Mönches enthaltend. Wir mußten übrigens auch die Schuhe abstreifen und mit Strümpfen Chor und Altarraum betreten. Ich weiß nicht, ob die Moslems diese Sitte von den Vorchristen für ihre Moscheen übernommen haben oder ob es umgekehrt ist. Neu und eindrucksvoll war mir, daß statt der in Moscheen und frühchristlichen Kirchen üblichen Öllämpchen zahlreiche Straußeneier hier von der Decke herabhingen. Dies soll das Sichversenken in Glaubensinbrunst symbolisieren, gleich wie die Straußenhenne sich in die Pflege ihrer Eier versenkt.
Im Vorraum des Kirchenschiffes sah ich ein in den Boden eingelassenes steinernes rundes Taufbecken, das zum Epiphanienfest zur Wassertaufe dient. Bei unserm gegenseitig schlechten Englisch konnte ich von unserem freundlichen Führer nicht erfahren, ob hier Kinder getauft werden oder das Becken zur Fußwaschung dient. Ein solches rundes Bodenbecken fand ich auch in den anderen Klosterkirchen. Ich will Freund Glasenapp mal befragen. Außer der Hauptkirche sahen wir auch eine Reihe von Kapellen, die alle als Rundgewölbe erbaut waren, die des Heiligen Georg, Heiligen Theodor usw.; da die stark zusammengeschmolzene Zahl der Mönche alle diese Kapellen neben der Marienkirche gar nicht mit Gebet und Pflege versorgen können; dienen sie heute als Lagerplatz für Psalmfasern, Mehlspeicher u.a. Auch das gemeinsame Refektorium, ein langer Steintisch und Steinbänke für die Mahlzeiten der Brüder und die anschließende malerische Großküche mit hohen Steingewölben liegen heute brach. Im Refektorium wurden bei unseren Besuch von jüngeren Mönchen gerade Wachskerzen gezogen. In einer Art Schuppen stand der Backofen und in seiner Nähe lagerten zahlreiche runde Brote etwa von der Gestalt der Berliner Schusterjungen. Der würdige Mönch – er fragte mich nach meinem Alter – war 61 Jahre. Er reichte jedem von uns solch ein Brot und – es schmeckte ausgezeichnet. Auf dem Weg durch den Garten zur Kapelle des Heiligen Johannes des Täufers begegnete uns ein eisgrauer Mönch, der aus seiner Kutte ein aus roten Ziegenleder kunstvoll geflochtenes Kreuz hervorzog und mir anbot. Der Alte wollte dafür 15 Piaster (etwa 1,50 DM), denn die Mönche leben in Armut. Gern nahm ich das Kreuz in Erinnerung an den Klosterbesuch im Natrontal. Nachdem Dr. Valic noch viele Fotos auch von unserem Führermönch, den ich zum Abschied 50 Piaster für die Kirche gab, gemacht hatte, bestiegen wir wieder unseren Jeep und hopsten mit ihm über Dünen und Steine durch die Wüste südwärts zum Deir es-Suryan (auch Deir el-Suryan), dem sogenannten Syrerkloster. Es wurde ursprünglich auch im 4. Jahrhundert von koptischen Mönchen erbaut, machte auch wie die anderen Klöster des Tales Überfälle durch westliche Wüstenbewohner mit und wurde 817 ausgeplündert. Zuvor hatten reiche Kaufleute aus Mesopotamien das Kloster für die damals in Ägypten wohnenden syrischen Glaubensgenossen gekauft, die das zerstörte Kloster 817 wieder aufbauten. Es ist das größte und reichste des Natrontales. Als im 14. Jahrhundert der schwarze Tod (black death - Blattern?, Pest?) Ägypten entvölkerte, hielt er auch unter den Mönchen furchtbare Ernte. Laut alten Manuskripten fand ein Besucher, der das Kloster 1413 besuchte, nur noch einen einzigen Mönch vor. Doch sorgte der Patriarch von Antiochia, dem die syrische Kirche unterstand, für Neubesiedlung des Klosters. Allmählich aber ging die Zahl der Mönche zugunsten der ägyptischen immer mehr zurück. Es ist heute wieder ein rein koptisches Kloster und hat nur den Namen als Erinnerung an die Syrer behalten. Freilich zeichnet es sich durch einige Eigentümlichkeiten aus. Dazu gehört, daß der Zutritt für Frauen nicht gestattet ist, und daß der Besuch von einer Erlaubnis Seiner Seligkeit abhängig ist, welche ich mir zuvor verschafft hatte. Auch das Syrerkloster ist seit Ende des 9. Jahrhunderts von einer großen Wallmauer umschlossen und wiederum läuteten wir am Glockenstrang, worauf sich das bekannte Frage- und Antwortspiel entwickelte. Lange mußten wir warten. Dann erschien in der Rahmung der Eingangstür eine zierliche Gestalt mit Gelehrtenkopf und Brille im schwarzen Mönchshabit und begrüßte uns freundlich. Ich nahm wieder die Vorstellung meiner Begleiter vor und dann führte uns unser Mönch direkt in die Bibliothek des Klosters. Hier servierte uns auf sein Geheiß ein junger Mönch mit klassisch schönen Arabergesicht und nackten Füßen je eine Tasse Zimttee, der nicht uneben schmeckte. Wir bewunderten dann handgeschriebene Bibeln in den drei Sprachen, koptisch, syrisch und arabisch. Auf meine Bitte las uns der Mönch koptisch vor. Es klingt wie griechisch. Die Klosterbibliothek enthielt zu meinem Staunen auch zahlreiche Werke von protestantischen Theologen und viele religiöse Bücher und Atlanten auch in englischer Sprache, die unser Führer hervorragend beherrschte. Der Ausspruch einer deutschen Pute in Alexandria, „die Mönche im Wādī an-Naṭrūn seien alles ungebildete arabische Bauernlümmel“, erwies sich also als ebenso falsch wie arrogant. Der Mönch erzählte uns auch, daß demnächst ein Mönch aus dem Syrerkloster oder dem Antoniuskloster nach Tübingen gesandt werden sollte, um dort koptische Bücher zu studieren. Das Syrerkloster enthielt einst eine berühmte Sammlung syrischer Manuskripte, die jetzt in der Bücherei des Vatikans stehen und auch bedeutenden syrischen Manuskripte des Britischen Museums stammen von hier. Immerhin konnte er uns mehrere Glasschränke voll alter Manuskripte zeigen, die das Kloster neben seiner umfangreichen Bücherei noch heute sein Eigen nennt. Sehr interessant war mir auch zu hören, daß Seine Seligkeit, das Oberhaupt der koptischen Kirche, stets aus der Reihe der Mönche der 7 Hauptklöster des Landes gewählt wird. Es sind dies die 4 Klöster der westlichen lybischen Wüste im Wādī an-Naṭrūn, ferner die 2 Klöster des Hl. Antonius und des Hl. Paul in der östlichen arabischen Wüste nahe dem Roten Meer und das Kloster bei Assiut in Oberägypten. Zahlreiche Heiligenbilder, vielfach vom Holzwurm arg zerstört, alte Holzschnitzereien und Gewebe, sowie eine Sammlung alter Waffen aus den Kampfzeiten des Klosters, darunter ein Rundschild aus Flußpferdhaut, der noch deutliche Spuren abgewehrter Schwerthiebe aufwies, konnten wir besichtigen. Die zweitürmige Hauptkirche As-Sitt Miryam (Jungfrau Maria) ist wesentlich reicher als die des Baramusklosters. Große Ebenholztüren mit Elfenbeineinlagen trennen den Chor vom Kirchenschiff. Eine syrische Inschrift erwähnt, daß sie 926 hier errichtet wurden. So stehen diese ehrwürdigen Holztüren schon über 1000 Jahre an ihrem Platz. Das Holz ist noch vorzüglich erhalten, von den Elfenbeineinlagen sind manche herausgefallen, aber man erkennt noch deutlich in der obersten Reihe St. Petrus, Maria, Christus und St. Markus, die darunter befindlichen Reihen zeigen Einlagen von Kreuzornamenten. Im Allerheiligsten ist der Boden mit einfachen Schilfmatten bedeckt, aber wir mußten beim Betreten auch hier die Schuhe ausziehen. In den Seitennischen Freskomalereien in Deckennähe aus dem ersten Drittel des 10. Jahrhunderts syrischen Ursprungs, die Himmelfahrt Christi und die Verkündigung der Maria darstellend. Eine syrische Inschrift „Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen“ und eine griechische Inschrift „Heil, der Herr sei mit Dir“ wurden mir von unserem gelehrten Führer übersetzt. Eine koptische Inschrift ziert die Reliquie des Heiligen John Kamé, dessen Gebeine nach Zerstörung und Zerfall seines Wüstenklosters hierher überführt wurden. Auch hier sah ich wieder viele Straußeneier hängen. Interessant war noch eine kleine Zelle in der Kirchenmauer, wo der Abt des Nachbarklosters Anba Bishoi seine Andacht abhielt, da er dazu in dem eigenen Kloster, das 2000 Mönche beherbergt haben soll, keinen Platz und Ruhe fand. Nach anderer Deutung soll Gott dem Anba (Vater) Bishoi in dieser Zelle selbst erschienen sein. Auch das Syrerkloster hat noch zahlreiche Kleinkirchen, so die Kapelle der 49 Märtyrer, genannt nach den 49 Mönchen, die beim 3. Überfall des Klosters durch die Berber die Flucht verweigerten und nach ihrer Niedermetzelung den Ruhm christlicher Märtyrer erlangten, die Kapelle des Heiligen Homos, des Heiligen Maruhha, des Heiligen Johann des Kurzen, im Fluchtturm eine Michaelkapelle. Die meisten verfallen und heute als Lagerraum dienend. Im Kirchenschiff der Maria lag ein Haufen Getreide, auf ihm ein Holzkreuz. Derzeit beherbergt das Syrerkloster nur noch 23 Mönche. So ist es nicht verwunderlich, wenn viele Gebäude aus der Glanzzeit des Klosters Zeichen des Verfalls zeigen. Das gilt auch für das ehemalige Refektorium, die einstige Küche usw., während das moderne Gästehaus und der gut bewässerte Garten einen guten Eindruck machen. Als besondere Sehenswürdigkeit gilt noch der Baum des Heiligen Ephraim, eine mächtige Tamarinde mit einem Stammumfang von 2,60 Meter, ist der Tradition nach entstanden aus dem Wanderstab, den der Heilige hier in den Boden steckte. Jetzt beschattet er die Druckerei des Klosters, die um ihn als Mittelstück erbaut ist und deren einstöckiges Dach er durchragt. Es werden in koptischen und arabischen Lettern hier heilige Schriften gedruckt. Auch die jenseits der Klosterumwallung in Anlage befindlichen Apfelsinenplantagen und Gemüsebeete, die uns unserer Führer noch zeigte, sprachen für den arbeitsamen Geist im Syrerkloster. Eine kleine Gabe für die Kirche des Syrerklosters lehnte der freundliche Mönch trotz der sichtbaren Armut des Klosters ab.
In Sichtnähe des Syrerklosters liegt das fast benachbarte Dair Anba Bishoi, das wir als drittes Kloster nun besuchten. Vater Bishoi, koptisch der Heilige Pishoi, war der Gründer dieses Klosters, entschlüpfte beim 1. Überfall nach Oberägypten. Später wurde dann sein Sarg in die Kirche des von ihm begründeten Klosters beigesetzt. Die Kuppelkirche ist dem Heiligen Bishoi (arabisch) geweiht. Sie weist eine schöne geschnitzte Kanzel, ebenso Holztüren auf. Im Hauptkuppelraum sind stufenförmig Steinbänke wie in einem Amphitheater angeordnet, aber sie bieten bestimmt nicht für 2.000 Mönche Platz, deren Zahl wohl eine der vielen Klostersagen sein dürfte. Eine Beschreibung des Torhauses, des Fluchtturms, des Gästehauses, der Mönchszellen und vielen Kapellen erübrigt sich, da sie sich von den beiden zuerst besuchten Klöstern in Anlage und Zustand kaum unterscheiden. Nur die Räume der ehemaligen Ölmühle – es stehen einige Olivenbäume im Klosterhof –, Getreidemühle und Weinpresse lassen auf den einst gehobenen Lebensstil dieses Klosters schließen, das auch heute noch einen besonders schönen Palmen- und Gemüsegarten hat. Der Zutritt ging unter den bekannten Zeremonien vor sich, nur daß diesmal als Führer ein schwarzbärtiger, flinker Mönch mit funkelnden Augen erschien, der ebenso ein arabischer Wüstenscheich sein könnte. Er und seine Mitbrüder erinnerten mich lebhaft an Ali Baba und die 40 Räuber. Er sprach nur einige gebrochene Worte englisch und ließ beim Abschied die Piasterscheine mit einer Schnelligkeit in seiner Kutte verschwinden, wie ein Habicht seine Beute schlägt. Von dem Besuch des vierten Klosters des Heiligen Makarios, das etwas abseits liegt, nahmen wir Abstand, da es uns zu viel Zeit gekostet hätte, denn die Sonne geht im Winter früh unter und es war schon halb 5 nachmittags geworden. So sollte uns nun der Jeep, nachdem ich als Mittagessen zwei hartgekochte Eier, das Klosterbrot, eine Banane und Apfelsine gegessen, über die Wüstenpiste wieder zu unserem Kraftwagen am Rasthaus, der großen Fahrtstraße Kairo - Alexandria schaukeln. Er schaukelte denn auch zunächst recht brav durch die Sanddünen und die Steinwüste – die Klöster der Syrer und des Vaters Pishoi liegen zwar auf einer Anhöhe beträchtlich unter dem Spiegel des Natronsees, aber dennoch 5 m unter dem Meeresspiegel – schaukelte uns in eine Sandverwehung und dann schaukelte er gar nicht mehr, sondern gab seinen Geist auf. So sehr der arabische Fahrer mit Eisenhammer und Zange auf ihn losschlug und mit einer Brechstange unter seinen Leib kroch und ihn dort bedrohte, er tat es einfach nicht mehr. Ich erklärte den vor uns sichtbaren alten Wagenspuren folgen zu wollen bis der wiederauferstandene Wagen mich einholen würde. Herr Held vom Deutschen Konsulat schloß sich mir an, während Attaché Dr. Schmidt und Dr. Valic optimistisch beim Jeep zurückblieben. Das Gehen war aber gar nicht so einfach. Immer wieder mußte ich den Sand aus den Halbschuhen kippen, über Steine stolpern, die man nicht gesehen hatte und beim Verfolgen ehemaliger Wagenspuren oft große Bogen laufen. Ab und zu schauten wir zurück. Wir sahen dann den Jeep und die Gestalten um ihn in einsamer Wüste, im Hintergrund die Klöster der Syrer und des Heiligen Phsoi. Vor uns lag der silbrige Spiegel des Natronsees, dahinter ein grüner Streifen von Palmen der Oase Wādī an-Naṭrūn und ganz links der Schornstein der Soda- und Glasfabrik. Die Sicht war fast verdächtig klar, zugleich sahen wir eine dunkle Wolke am Himmel. Bald setzte ein Wolkenbruch ein. Wir waren indessen aus der Dünenregion in die Seeebene herabgestiegen. Hier bot sich ein einmaliges Bild: Die Sonne hatte die Seeufer und einen Landstreifen, der sich zwischen zwei der vielen Natronseen schob und den auch die Piste durchschnitt, zum Verdunsten gebracht und der Boden war weithin mit unendlich vielen weißen Natronkristallen bedeckt. Es sah aus wie eine große Schneelandschaft und erinnerte an die verschneiten Weiten Bessarabiens und der rumänischen Tiefebenen, wie ich sie 1941 gesehen habe. Aber hier gab es doch einen großen Unterschied, der Regen hatte alle die Salzgebilde auf den Erdschollen nicht aufgelöst, aber naß und glitschig gemacht und nunmehr hörte das Gehen auf und ein Schliddern, Glitschen, Rutschen und Stapsen begann. Der Regen rann wie an einer Wassertraufe an uns herab, meinen Knirps hatte ich wegen der Frühregen zwar mitgenommen, bei Ausbruch des Sonnenscheins aber im Wagen beim Rasthaus liegen lassen. Bald waren meine Schuhe, die durch die Salzkristalle angeätzt wurden und mit Schlamm und Natron völlig verschmiert waren, ein Bild des Jammers, auch die Strümpfe waren nur noch nasse Lappen. Zwar hatte ich den Regenmantel an, aber die darunter hervorschauenden Hosen waren bald so nass wie Kragen und Hemd, in die die Regenbäche vom bloßen Kopf herabrieselten. Bei dieser hervorragenden Kopfwäsche, die eine volle Stunde anhielt, war es natürlich, daß ich alle 20 Meter etwa einmal stehen blieb, um neuen Halt auf dem schlüpfrigen Glibber zu finden. So war das Rückschauen leicht und richtig sahen wir nun drei Gestalten, also auch den Fahrer mit unseren beiden Fahrtkameraden durch den Regen fürbass wandern. Sie hatten es also aufgegeben auf des Jeeps Wiedergeburt zu hoffen. Wir durchschritten, besser gesagt durchtaumelten nun die Landbrücke zwischen den beiden Natronseen. Da sahen wir die ersten schwarzen Beduinenzelte und einige Esel. Ich hatte nicht übel Lust, mir einen solchen zum Ritt einzufangen. Aber Esel sind gar nicht so dumm, wie sie im Rufe stehen. Sie ahnten wohl meine Gedanken und setzten sich trotz des Regens in flottem Trab von uns ab. Endlich, endlich hatten wir die feste Straße erreicht, die zur Sodafabrik parallel zum Seeufer durch das Tal führt. Nun ließ auch der Regen nach. Die anderen hatten uns eingeholt, sahen wie nasse Vogelscheuchen aus und die Baskenmütze des Herrn Attaché hatte so viel Wasser gezogen, daß er sie mehrfach auswringen musste. Da halte ich den bloßen Kopf für angenehmer. Beduinenkinder trieben eine Ziegenherde hinter uns her. Diese Vierbeiner laufen erstaunlich schnell und hatten uns bald eingeholt, genauso nass wie wir, aber mit ihren Fellen und Hufen wesentlich besser für solche Expeditionen ausgerüstet. Schließlich hatten wir auch die Stelle erreicht, wo meine Schuhe beim ersten Versuch des Klosterbesuches stecken geblieben waren. Sie lag gut 8 km vom Kloster entfernt. Hier mussten wir überlegen, ob wir die Straße ins Dorf Wādī an-Naṭrūn folgen sollten und dort vielleicht versuchen ein Gefährt zu bekommen (was unser arabischer Jeepführer für sehr fraglich hielt) oder direkt über Stock und Stein zum Rasthaus – etwa 4 Kilometer – zu marschieren. Wir entschieden uns für letzteres. Inzwischen war auch die Sonne untergegangen, der Regen hatte aufgehört und wir kletterten von der Seehöhe bis zum Rasthaus den steinigen Berg bei Viertelmond hinauf. Nach einer Stunde und 10 Minuten tüchtigen Marsches, wobei wir jedes Stehenbleiben in den triefenden Kleidern vermieden, kamen wir durch den Wind und die Bewegung schon ziemlich getrocknet, oben an. Die andern wollten in dem ungeheizten zugigen Rasthaus erst etwas trinken, ich plädierte aber für umgehende Heimfahrt. Man stimmte zu, es wurde die Heizung im Auto angestellt und Herr Held fuhr uns mit 100 - 120 km Geschwindigkeit über die regenglitzernden Straße – was mir viel unangenehmer war als der ganze zweieinhalbstündige Marsch – durch die Pfützen und die Dunkelheit heim, wobei die anderen ihn scherzhaft und mit Recht „Herr Admiral“ titulierten. Um 9 Uhr abends stand der Wagen vor dem Pelizäusheim, wo die guten Schwestern sich schon gesorgt hatten und mit dem warmgehaltenen Abendessen warteten. Ich war doch sehr zufrieden und beglückt, daß mir das große Erlebnis des Besuches der Klöster im Wādī an-Naṭrūn zu Teil geworden war, das doch nur ganz wenigen Besuchern Ägyptens vergönnt sein dürfte. Dafür musste ich schon einige Unbequemlichkeiten in Kauf nehmen. Während meine jüngeren Gefährten über scheußlichen Muskelkater nach dem Regenmarsch stöhnten (die jungen Herren sind, wie der Berliner sagt, feine Pinkel, die nur Auto fahren und Gehen ungewohnt sind), spürte ich nichts, da ich von jeher gern wandere und laufe. Aber nach dem Schlaf im ungeheizten Zimmer (die Nächte kühlen ziemlich ab) erwachte ich am nächsten Morgen mit ziemlicher Heiserkeit. Vorsorglich wollte ich ein heißes Bad, noch lieber ein Schwitzbad nehmen. Aber die Badewanne des Pelizäusheimes steht in der ungeheizten Toilette und der alte Gasofen, der das Wasser erwärmen soll, riecht dauernd nach Gas und ist wenig vertrauenserweckend. Ich fragte nach einer Sauna. Solche gibt es nicht in Alexandria. Man badet im Sommer in der See oder einem der Freiluftbäder des Klubs, aber im Winter geht das nicht. Also in ein türkisches Bad, das ich von der Türkei her zu schätzen gelernt hatte. Da geht ein Europäer nicht hin, die sind viel zu primitiv, entgegnete man mir. Nun fehlt es mir am Europäer-Dünkel und ich machte mich auf den Weg, fragte einen Schutzmann mit meinen drei Worten arabisch nach einem türkischen Dampfbad (Hamam). Er gestikulierte mi Zeichensprache und pfiff einen kleinen arabischen Buben, einen richtigen Dreckspatz mit nackten Füßen, herbei, der mich führen sollte. Das tat er dann auch und führte mich in einen Laden dessen beide Wände mit Holzkäfigen vom Boden bis zur Zimmerdecke bedeckt waren und in diesen Käfigen saßen -- Tauben. Schokoladenfarbige, schneeweiße, blauschillernde, gesprenkelte Tauben. Die Auswahl war enorm und zeigt die Liebhaberei der Araber, die nächst schönen Pferden Tauben züchten, wie ja auch die zahlreichen Taubenhäuser in den Dörfern beweisen. Ich schüttelte verwundert den Kopf, wiederholte das Wort Hamam und der Junge führte mich nun durch verschiedene winklige Gassen in einen anderen --- Taubenladen. Er mochte glauben, daß ich eine Lieblingsfarbe im ersten Laden nicht gefunden habe. Erst ein französisch sprechender Passant konnte das Rätsel lösen. Bad heißt auf Arabisch „Hammām“ (حمّام). Das war ein lehrhaftes Beispiel für mich, wie schwierig die richtige Aussprache arabischer Wörter ist. Mit der gleichen Beharrlichkeit wie beim Klosterbesuch, versuchte ich nun ein türkisches Hamam zu finden und stand schließlich vor einem solchen. Ich trete in den von einer Kuppel überdeckten großen Hauptraum, den Meschlach. In der Mitte plätschert ein Springbrunnen, an den Wänden stehen auf einem Podium zahlreiche Diwans (Ruhebänke). Freundliche Gesichter empfangen mich, ich gebe Uhr und Geldbörse ab, die in einem kleinen Beutel verschwinden. Da es noch Vormittagsstunde ist, finde ich nur zwei Besucher vor. Einer ruht nach dem Bad auf dem Diwan, der andere trinkt Kaffee. Die Araber baden meist erst abends nach der Berufsarbeit oder noch später, da das Bad die ganze Nacht geöffnet bleibt, So habe ich praktisch das ganze Bad für mich allein. Man führt mich durch einen zweiten Ruheraum mit Diwans drei Holzstufen hinauf in ein Zimmer mit drei Diwans und großem Wandspiege, eine Art 1. Klasse. Hier hänge ich an Holzhaken meine Sachen auf. Dann erscheint ein Badediener, der Abu Kix (der Vater des Lappens), mit drei Tüchern, ein blaukariertes schlingt er mir um die Hüften, ein rotkariertes um den Brustkorb und ein ebensolches über Schultern und Kopf. So stehe ich wie in einem japanischen Sarong da. Dann bringt er mir die Kabkab (Holzpantoffeln) und geleitet mich durch den Meschlach in den Schwitzraum (Harara) Hier nimmt er mir alle Tücher wieder ab. Eine mollige Wärme umfängt mich. In der Raummitte ein großes Steinbecken mit warmen, fließendem Wasser, an den Wänden Steinbänke. Ich beginne zu schwitzen, muß dann einige Steinstufen in eine Badekammer steigen, in der ein großes Bassin zum Baden und Schwimmen ist. Vorsichtig stecke ich einen Fuß in das Schwimmbassin, ziehe ihn aber sofort zurück, denn das Wasser ist teuflisch heiß. Ich werde an meine japanischen Badefreuden erinnert. Scheinbar können die gelb- und braunhäutigen Menschen mit ihrer Haut andere Hitzegrade vertragen als wir sie gewohnt sind. Ich beschränke mich also, im gleichen Raum unter zwei dort angebrachte Duschen lau und heiß zu duschen. Nach dieser Vorbereitung empfängt mich der Abu sabun, d.h. der Vater der Seife. Er führt mich in ein Gemach mit Wasserleitung und einer Steinbank. Über diese breitet er in ganzer Länge ein dunkelblaukariertes Tuch, auf das ich mich legen muß. Und nun beginnt der Vater der Seife sein Werk. In der Hand hat er ein Stück Seife und Lifa. Lifa (Lufa) ist ein bastartiges Gebilde, das von einer gurkenartigen Frucht einer Kletterpflanze stammt, die auch im Garten des Pelizäusheimes wächst. Der Abu sabun begann also mich mit Lufa zunächst einmal gründlich durchzuschrubben. Linkes Bein, rechtes Bein, Bauch, Brust, linker Arm, rechter Arm. Dann musste ich mich bäuchlings legen und die gleiche Prozedur geschah an der Hinterfront. Darauf abgießen mit einer Schale heißen Wassers. Die starke Hautmassage des Schrubbens macht eine sehr gute Durchblutung, ich fühlte förmlich, wie meine Erkältung dahinschwand. Das aber war nur die Vorbereitung bzw. der erste Akt. Denn nun begann der Vater der Seife mich in ein schäumendes Seifenbündel zu verwandeln. Mit Lifa und Seife wurden der Reihe nach die Körperpartien eingeseift und auch der Kopf nicht vergessen. Dann wieder Übergießungen und anschließend Massage der gelockerten Gliedmaßen. Endlich ließ der Abu sabun, dem selbst bei seiner Arbeit die Schweißperlen auf die Sterin getreten waren, von seinem Opfer ab und entließ mich in den Harara. Hier klatsche ich in die Hände und rief ‚Fuwat‘ (Tücher. Aber meine arabische Aussprache war wohl wieder so mangelhaft, daß sie niemand verstand. Ich duschte daher noch einmal und versuchte es dann mit dem Singular ‚futa‘ (Tuch). Ob dies geholfen hat oder ob Allah ein Einsehen hatte, jedenfalls erschien nun ein Badediener mit Tüchern. Ein großes Laken wurde um mich geschlagen, ein Schultertuch und aus einem Frottiertuch wurde mir ein herrlicher Turban um den Kopf gewunden. Ich zog die Kabkab wieder an und klapperte nun durch den Meschlak wieder in mein Appartement 1. Güte, wo ich mich auf den mittleren Diwan niederlegte. Nun wurde ich mit frischen Tüchern bedeckt und erneut massiert. Das geschieht sehr dezent mit bedecktem Körper, da die Araber sehr genant sind und nach den Vorschriften des Korans niemand selbst im Schwitzbad seine Blöße unbedeckt lassen darf. Zunächst wurde jeder Zeh lang gezogen, als ober ausgerissen werden sollte. Es folgte das Gleiche mit den Fingern bis es knackte. Darauf wurden die Arme über der Brust verschränkt und an die Rippen gepresst, daß der ganze Brustkorb zerquetscht zu werden drohte. Zwischendurch Massage der tücherbedeckten Beine, Arme, Rumpf. Endlich mußte auch der Kopf daran glauben, er wurde nach links gedreht bis es knackste und ebenso nach rechts. Diese arabischen Badediener verstehen die Chiropraktik und es war fast schade, daß ich keinen Bandscheibenschaden habe. Er wäre bestimmt geheilt worden. So aber war meine Erkältung geheilt. Ich war nach beendeter Massage so wohlig ermüdet, daß ich etwa 45 min oder 1 Stunde auf meinem Ruhebett schlief. Der Araber pflegt dann einen Kaffee zu trinken. Es gelang mir jedoch nicht, dem Badediener klar zu machen, daß ich ihn ohne Zucker wünschte. Vermutlich ist dies auch unmöglich, denn das feingemahlene Kaffeepulver wird in die kochende Zuckerlösung geschüttet, die man schnell dreimal hintereinander aufkochen lässt. Das schaumige Getränk wird dann in kleinen Tassen gereicht. Auf diesen Genuss verzichtete ich zum Erstaunen des Badepersonals. Die Uhr zeigte mir, daß ich zweieinhalb Stunden für mein Bad benötigt hatte. Ich gab dem Vater der Tücher, dem Vater der Seife und dem Masseur je 2 Piaster Trinkgeld, zog meinen vorsorglich mitgebrachten roten Wollsweater an, legte den Wollschal um, zog den inzwischen vom Klosterbesuch wieder getrockneten Regenmantel an, nahm mir ein Taxi und traf gerade zu Mittag wieder im Pelizäusheim ein. Noch nie hatte ich so guten Appetit wie an diesem Mittag. Nachdem ich so Heiserkeit und Erkältung durch das Hammam losgeworden war, war das Abenteuer des Wādī an-Naṭrūn erst richtig beendet.
Nachbemerkung:
Die vorstehenden Reiseeindrücke fanden randständig Niederschlag in seinem wissenschaftlichen Beitrag „Arbeitsmedizin in Ägypten“, der im Dezember 1959 im Zentralblatt für Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz, Band 9, Heft 12, Seite 293-295 erschien.
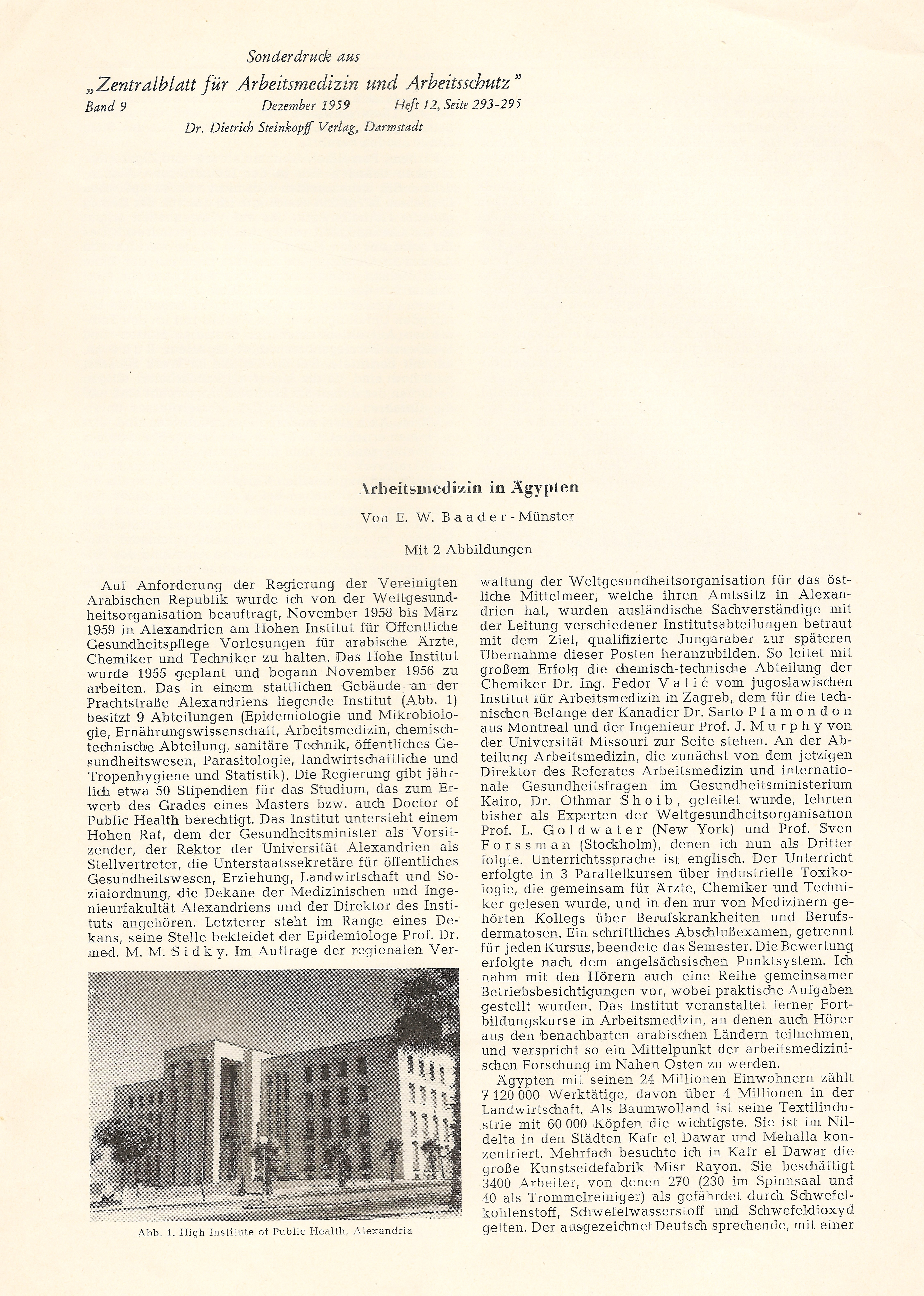

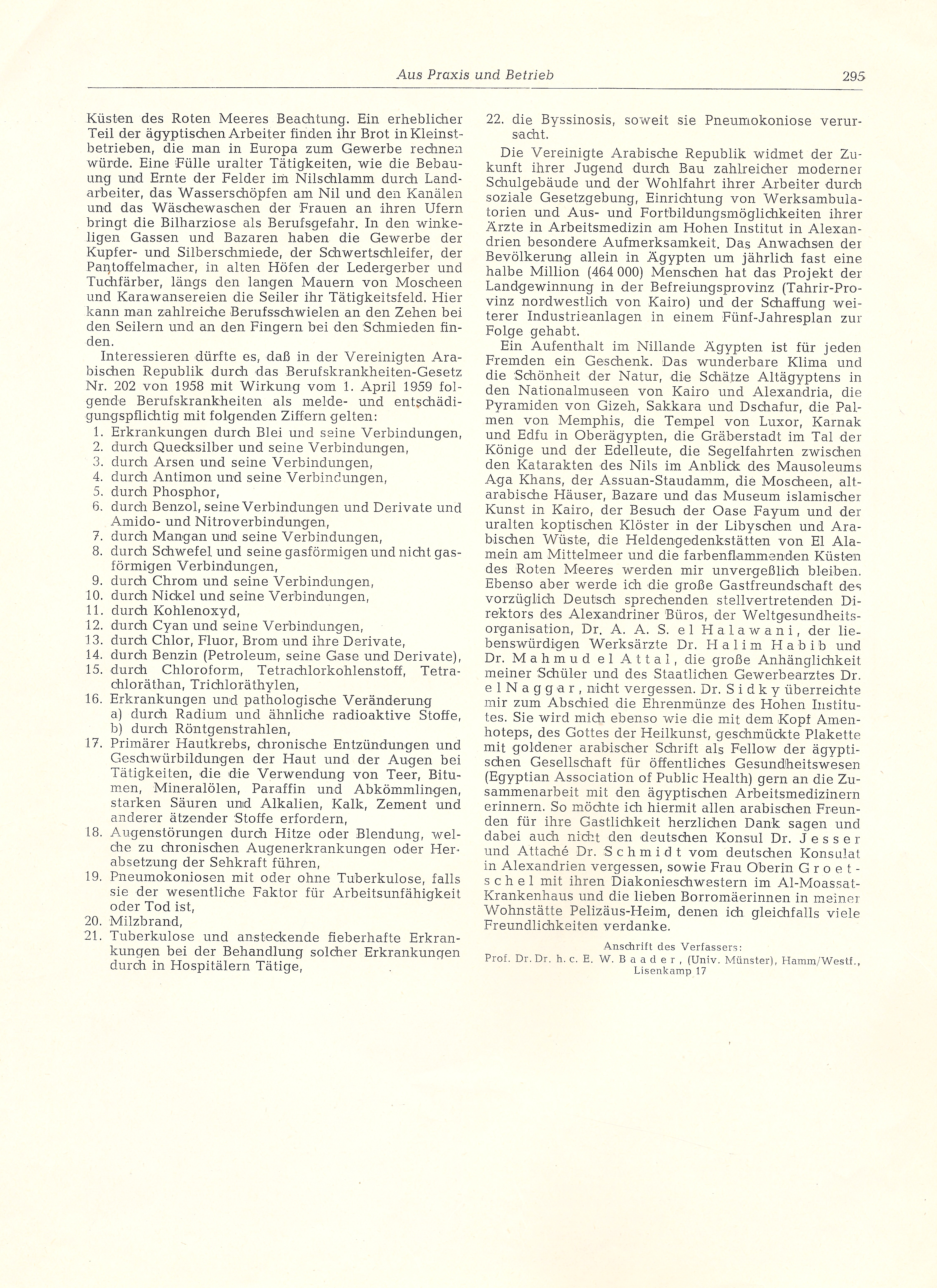
[1] Abbildung gemeinfrei. Aus Lange-Diercke – Sächsischer Schulatlas, Ausgabe für Dresden. Herausgegeben unter Mitwirkung des Dresdner Lehrervereins, Dresden 1930.

